In der Beschreibung dieses Blogs heißt es, dass es darin um Bücher, Texte und Leseerlebnisse geht. Manchmal werde ich gefragt, was unter einem Leseerlebnis zu verstehen sei, doch darauf gibt es keine eindeutige Antwort. Es kann etwa ein Buch sein, das mich zurückführt in eine vergangene Zeit meines Lebens, so, als würde ich in einen Spiegel schauen. Oder ein Roman, in dem eine mir wenig bekannte Epoche so intensiv vor mir ausgebreitet wird, wie es mit literarischen Mitteln nur möglich ist. Ein Buch, das seltsame Träume auslöst. Oder eines, das mich so tief in die Handlung hineinzieht, dass ich mich danach wochenlang auf keine neue Lektüre einlassen kann. Und manchmal kann ein Leseerlebnis lediglich aus einer kurzen Textstelle* bestehen oder aus einem einzigen Satz; wenn ich dort Worte finde, die etwas in mir verändern. Worte, die mich mitten ins Herz treffen. Die Trost spenden und eine offene Wunde schließen. Oder zumindest ein Pflaster darauf kleben. Und genau solch ein Pflaster, solch eine Textstelle ist mir auf den ersten Seiten des Romans »Chamäleon« von Annabel Wahba begegnet. Davon möchte ich hier erzählen.
»Chamäleon« ist ein Roman, den ich schon etliche Wochen vor seinem Erscheinen gelesen habe, denn er erscheint in dem Verlag, für den ich arbeite. Doch ich schreibe hier nicht als Verlagsmitarbeiter, sondern als Leser, dem mit einem Satz in diesem Buch ein großes Geschenk gemacht wurde. Ganz unverhofft.
Die Autorin berichtet in »Chamäleon« von ihrer deutsch-ägyptischen Familiengeschichte, nimmt uns Leser mit in die Nachkriegszeit im zerbombten München und in eine ägyptische Stadt im Nildelta, beschreibt zwei junge Menschen, die sich in den Fünfzigerjahren aufmachten, die Welt zu entdecken und die Liebe ihres Lebens fanden. Eine Familie gründeten, in Kairo lebten, bis sie die Stadt Hals über Kopf verlassen mussten, nach München zogen und sich schließlich mit ihren vier Kindern – der Ich-Erzählerin und ihren drei Geschwistern – in der bayerischen Provinz niederließen. In der autofiktionalen Erzählung geht Annabel Wahba den Fragen nach, wie Herkunft das eigene Leben beeinflusst und inwieweit die Zugehörigkeit zu verschiedenen Kulturen chamäleonhafte Anpassung bedeutet. Oder sie manchmal sogar notwendig macht; immer mit der Gefahr, sich selbst dabei zu verlieren.
Der Anlass für dieses Buch war ein trauriger: Vor wenigen Jahren starb André, der Bruder Annabel Wahbas, an einer tückischen Krebserkrankung. In seinen letzten Tagen versammelte sich die Familie an seinem Sterbebett, und in den Gesprächen mit ihm – solange sie noch möglich waren – ging es viel um ihre deutsch-ägyptische Herkunft, um die weitverzweigte Familie und um gemeinsame Reisen, die nie stattgefunden hatten. Das Sterben des Bruders ist der erzählerische Rahmen der Geschichte, eingebettet darin schreibt die Autorin über die Vergangenheit, über ihre Vorfahren in Deutschland und Ägypten. Und über ihre eigenen Erinnerungen. Mehr zum Buch? Eine lesenswerte Besprechung gibt es zum Beispiel im Literaturblog Kulturbowle. Und in einem kurzen Film spricht die Autorin selbst über die Entstehungsgeschichte des Werkes.
Nun aber zu der Textstelle, die mir so wichtig geworden ist.
Der Prolog führt uns in den Februar 2019, es sind die letzten Stunden Andrés. Und die Ich-Erzählerin Annabel Wahba berichtet, was sie von Ruth – einer Sterbebegleiterin, die der Familie zu Seite steht – erfährt:
»Jetzt, da du im Sterben liegst, will ich so viel Zeit wie möglich in deiner Nähe verbringen. Am liebsten würde ich dich umarmen und nicht mehr loslassen. Aber wir sollen dich nicht zurückhalten, hat Ruth gesagt. Sterben ist Arbeit, und diese Arbeit müssen wir dich jetzt machen lassen. Sterbende Menschen suchen sich einen unbeobachteten Moment, um zu gehen, einen, in dem sie allein sind. Tiere machen das ähnlich, sie verstecken sich draußen in der Natur, wenn sie merken, dass ihr Ende kommt.«
Es ist dieser eine Satz, den ich regelrecht aufgesogen habe, der mir seitdem nicht mehr aus dem Kopf geht. Und der dafür sorgt, dass etwas Frieden in meinen Gedanken eingekehrt ist: »Sterbende Menschen suchen sich einen unbeobachteten Moment, um zu gehen, einen, in dem sie allein sind.«
An einem Nachmittag im April 2020 saß ich selbst an einem Sterbebett in einem Krankenhaus am Bodensee. Ansprechbar war meine Mutter schon seit vielen Wochen nicht mehr, doch es würde nun nicht mehr lange dauern. Einen Tag noch, vielleicht auch zwei. Mein Bruder und ich waren da, um Abschied zu nehmen, allerdings durften wir nur abwechselnd zu ihr – es war die Zeit des ersten Corona-Lockdowns. Etwas mehr als eine Stunde, nachdem wir abends das Krankenhaus verlassen hatten, kam der Anruf – es schien so, als hätte sie nur noch auf uns gewartet gehabt. Die Situation war schon fast gespenstisch: Wir standen mitten in den menschenleeren, vollkommen stillen Altstadtgassen der Stadt am Bodensee, in denen um diese Zeit normalerweise das Leben pulsierte, als das Mobiltelefon klingelte und uns das Krankenhaus über den Tod unserer Mutter informierte. Sie war einfach eingeschlafen und hatte zu atmen aufgehört.
Warum waren wir – oder der Umstände halber – nicht wenigstens einer von uns bei ihr gewesen bei ihrem letzten Weg? Warum waren wir nicht noch etwas länger geblieben? Am nächsten Morgen hatten wir so früh wie möglich wieder zu ihr fahren wollen, aber jetzt war es zu spät – und seit diesem Tag habe ich mir deswegen Vorwürfe gemacht. In dem Text über Daniel Schreibers großartiges Buch »Zuhause«, das ich unmittelbar nach dem Ausräumen des Elternhauses gelesen habe, schrieb ich: »Ihr Tod mag die Erlösung nach einem langen Leidensweg gewesen sein, aber er hat mich vollkommen aus der Spur geworfen. Und jetzt, wo ich diese Sätze schreibe, merke ich, dass ich noch weit davon entfernt bin, zu dieser zurückzufinden – falls es sie überhaupt noch gibt.« Der Gedanke, sie zum Schluss alleine gelassen zu haben, trug zu einem großen Teil zu diesem Gefühl bei. Und er ging mir nicht mehr aus dem Kopf, keinen einzigen Tag.
Dann dieser Satz: »»Sterbende Menschen suchen sich einen unbeobachteten Moment, um zu gehen, einen, in dem sie allein sind.«
Ich saß da und starrte das Buch an. Las ihn noch einmal. Und noch einmal. Dann, ganz langsam, fühlte es sich so an, als würde ein großes Gewicht von meinen Schultern genommen. Als würde sich die Klammer des Selbstvorwurfs lockern und mir helfen, mit dem Erlebten endlich Frieden zu schließen. Und meine Mutter endgültig gehen zu lassen.
Es sind lediglich sechzehn Wörter. Doch eine kurze Textstelle wie diese, ein einziger Satz kann vieles verändern. Deswegen habe ich das alles aufgeschrieben, denn dieses Erlebnis hat mir ganz unmittelbar gezeigt, welche Macht das geschriebene Wort haben, welchen Trost es spenden, welche Wunden es verarzten kann.
Sechzehn schlichte Wörter. Und ein Satz wie ein Geschenk.
Danke dafür.
* Hier auf Kaffeehaussitzer gibt es die Textbausteine, eine Sammlung von Texten, die mir wichtig sind.
Buchinformation
Annabel Wahba, Chamäleon
Eichborn Verlag
ISBN 978-3-8479-0097-9
#SupportYourLocalBookstore

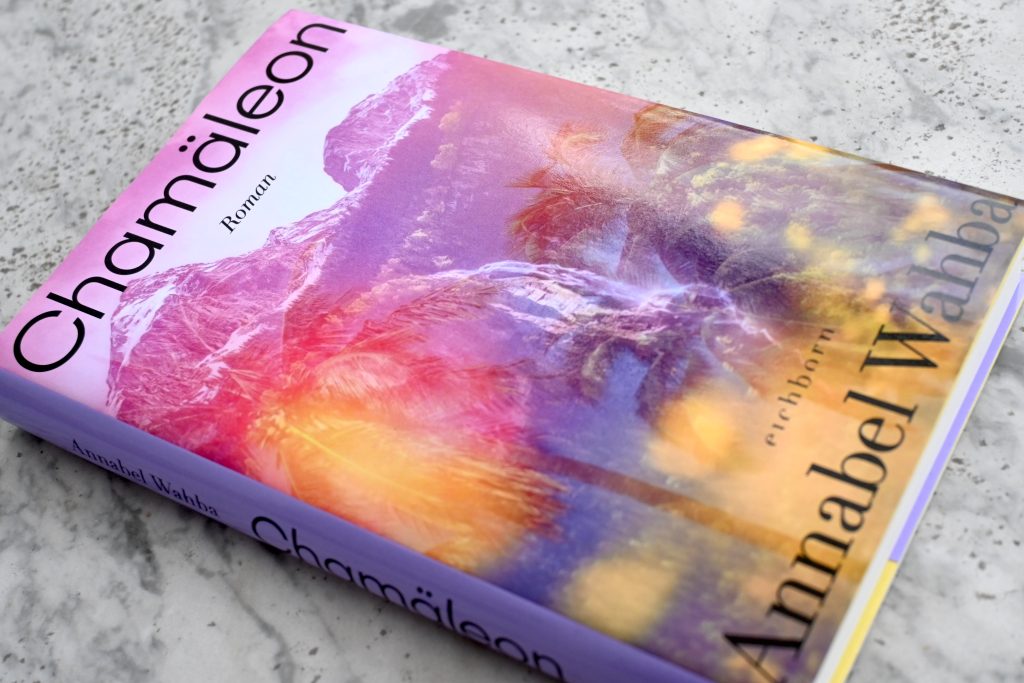
zu dem tollen blog beitrag „ein satz wie ein geschenk“, der in zweifacher hinsicht aufs essentielle abzielt, möchte ich bemerken: 1) ja, es gibt sie,, die grossen augenöffner !!! einen solchen satz als lesende zu finden, kommt einer erleuchtung gleich. für mich war es der titel von cees nootebooms brevier: „ich hatte tausend leben und nahm nur eins“. genau das hatte ich ein 70 jahre lang währendes leben (mit einigen erkennbar grossen kreuzungen, an denen entscheidungen fallen mussten), vermutet, hätte es aber nicht so deutlich ausdrücken können.
2) alles, was vom sterben handelt, geht uns ja auch alle essentiell an. nach vielen studien dazu möchte ich peter fenwick, den international renommierten englischen neuro-psychiater, empfehlen mit dem buch „the art of dying“ bzw. das interview mit ihm auf you-tube: „what really happens when you die“. auch sprachlich-mental äusserst beruhigend, just lovely …
Danke für den Kommentar und die Lektüreempfehlungen.
sehr gern, herr kalkowski, und
kommen sie doch mal ins verhuschte „kornfeld“ (café), wenn sie das nächste mal mit dem buch unter dem arm in berlin sind!
Von einer ganz lieben Freundin als Geschenk auf diesen Satz aufmerksam gemacht, habe ich die Einträge mit ganz großen Interesse und persönlicher Betroffenheit gelesen. Ende August 2022 verstarb meine liebe Frau kurz nachdem ich das Krankenzimmer für etwa 20 Minuten verlassen hatte. „Meine“ Krankenschwester erzählte mir mit unvergleichlichem Einfühlungsvermögen, wie häufig sich das Sterben so zuträgt. Ich hätte die letzten Momente gerne mit meiner Frau geteilt, sie hat anders entschieden. Wahrscheinlich war es für alle das Beste.
Dank an alle, die diese ihre Erfahrung mitgeteilt haben.
Josef
Meine aufrichtige Anteilnahme und vielen Dank für das Teilen dieser traurigen Erfahrung.
Herzliche Grüße
Uwe
Lieber Josef,
ich musste beim Lesen von Uwes Beitrag und dem Satz, wann Sterbende gehen, genau wie Du an die Erfahrung denken, als mein erster Mann nach schwerer Krankheit in einem kleinen Moment des Alleinseins ging. Still, vorher noch ganz da, auf mich wartend.
Auch mir berichteten die Krankenschwestern und -pfleger das gleiche und auch hätte ihn begleiten wollen. Doch wahrscheinlich ist es so, dass dieser letzte Weg oftmals (nicht immer) am besten alleine gegangen werden kann.
Danke, Uwe, für diesen Beitrag. Das Buch werde ich mich besorgen.
Herzlichst,
Barbara
Liebe Barbara,
vielen Dank für Deinen so persönlichen Kommentar zu diesem Text.
Herzliche Grüße
Uwe
Ich stöbere in deinem wundervollen Literatur-Blog, stoße auf den Begriff „Leseerlebnis“, lese, und bin mit einem Schlag so vollkommen berührt, alles steigt wieder auf, Tränen kommen, ich weine, es hört garnicht mehr auf. Ich glaube, dass das ein Stück Verarbeitung ist.
Da habe ich mein Leseerlebnis!
Ich bin dir sehr dankbar.
Dein Bruder Detlef
Ich danke Dir. Wir sehen uns bald, ich freue mich schon darauf.
Liebe Grüße
Uwe
Ein wunderbarer Blog-Artikel mit berührendem Inhalt. Danke!
Ich bin Krankenschwester und habe diesen Satz schon oft gehört……will sagen, das ist nicht die Erfahrung einer einzigen Sterbegleiterin, sondern schon lange eine sehr häufige Beobachtung….und auch, dass Sterbende anscheinend ein wenig Einfluss auf den Zeitpunkt ihres Sterbens haben, wie auch Ihre Erfahrung zeigt (also eine Stunde, nachdem ihre Kinder noch einmal da waren) …….im Grunde ist es, so merkwürdig das klingt, ein Grund zur Dankbarkeit, dass sie beide trotz Lockdown (!) noch einmal zu Ihrer Mutter durften im richtigen Moment und sie danach so friedlich einschlafen konnte….alles richtig gemacht!!
Vielen Dank für diesen Kommentar.
Oh wie gut kann ich es nachvollziehen. Meine Mutter musste zuletzt noch ins Krankenhaus, ich hatte den Morgen neben ihr gelegen, ihre Hand gehalten. Gehen könnte sie dann kurz nachdem sie im Nähe gelegen Krankenhaus war. Mein Vater ist einfach eingeschlafen, als meine Schwester kurz einkaufen war. Beide Male dachten wir uns kurz, wären wir doch … aber es ist kein Versäumnis. GLG, Brigitte
Danke, liebe Brigitte
Tröstlich und wunderbar. Ich habe ähnliche eigene Erfahrungen und kann das nur zu gut nachfühlen.
Da sind Erfahrungen, die die meisten von uns eines Tages machen werden – vielleicht hilft der Satz auch anderen, damit umgehen zu lernen.
Respektvollen Dank für diese literarisch inspirierte und persönliche Trauerreflexion. Mag es nach einem oder zwei, vielleicht auch nach fünf Jahren sein – ein solcher Satz oder Gedanke kann so lösend sein.
Herzliche Wünsche und Grüße
Dankeschön.
Dankeschön für diesen wunderbaren Beitrag, der in sehr persönlichen Worten beschreibt, welches Geschenk dieses Buch ist und warum es so ungemein lesenswert ist! Und es gibt noch viele weitere wunderbare Aspekte und Textbausteine in „Chamäleon“ zu entdecken…
(P.S.: Darüber hinaus natürlich auch ein herzliches Dankeschön fürs Verlinken!)
Deine Besprechung beschreibt das Buch auf eine wunderbare Weise. Wenn ich es noch nicht kennen würde, wäre ich dadurch sehr neugierig geworden.
Was für ein ergreifender kleiner Essay – so persönlich einerseits und so sehr tröstlich und lebensklug andererseits! Ganz herzlichen Dank!
Danke für den Kommentar.