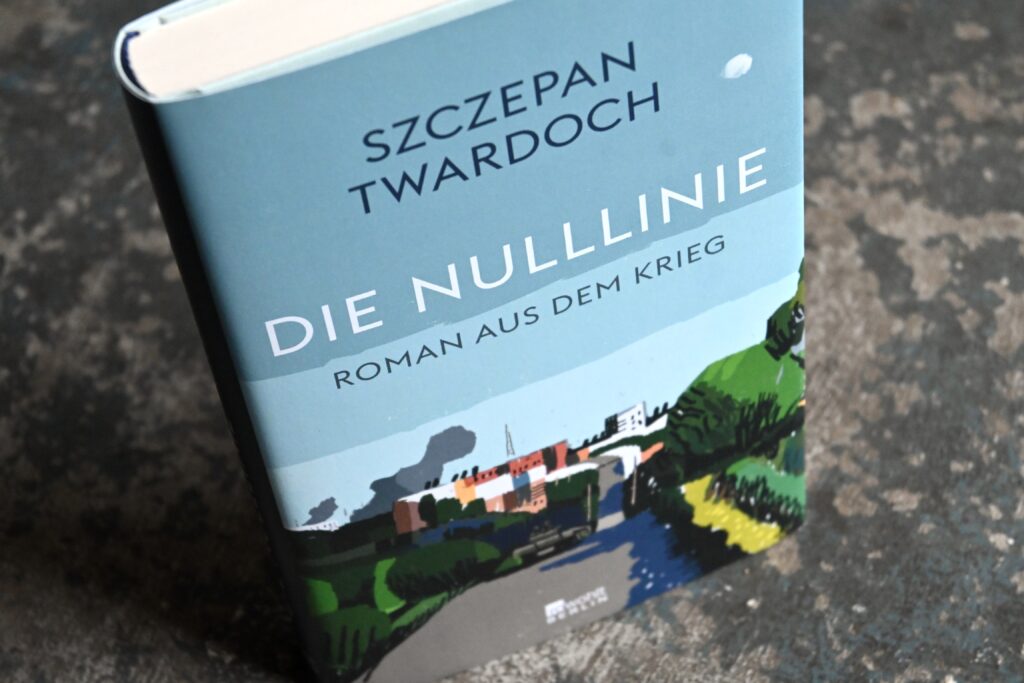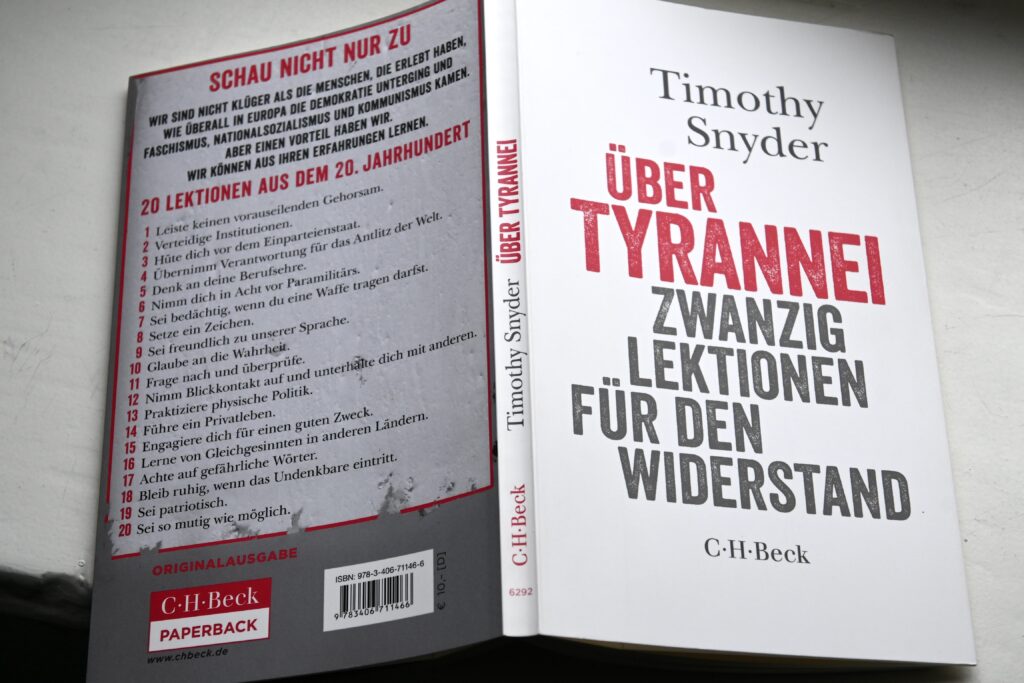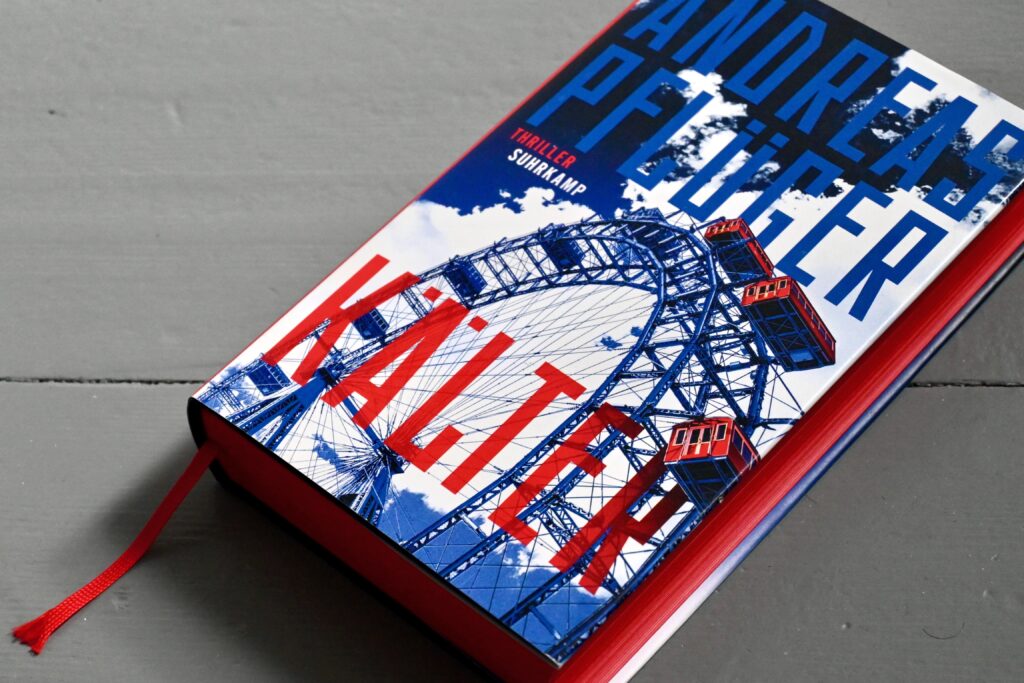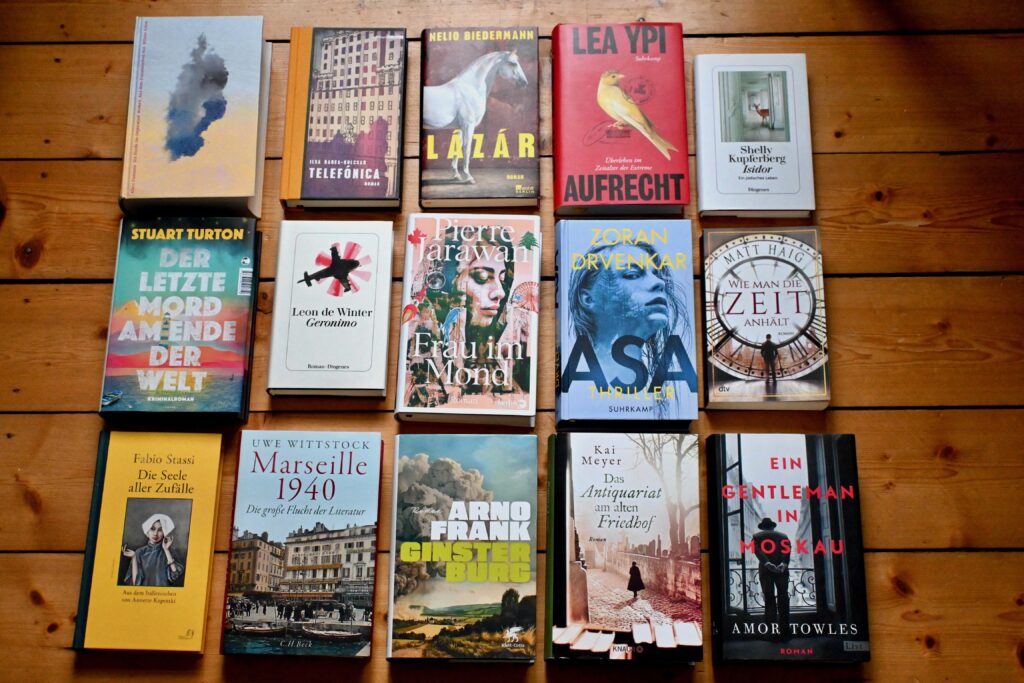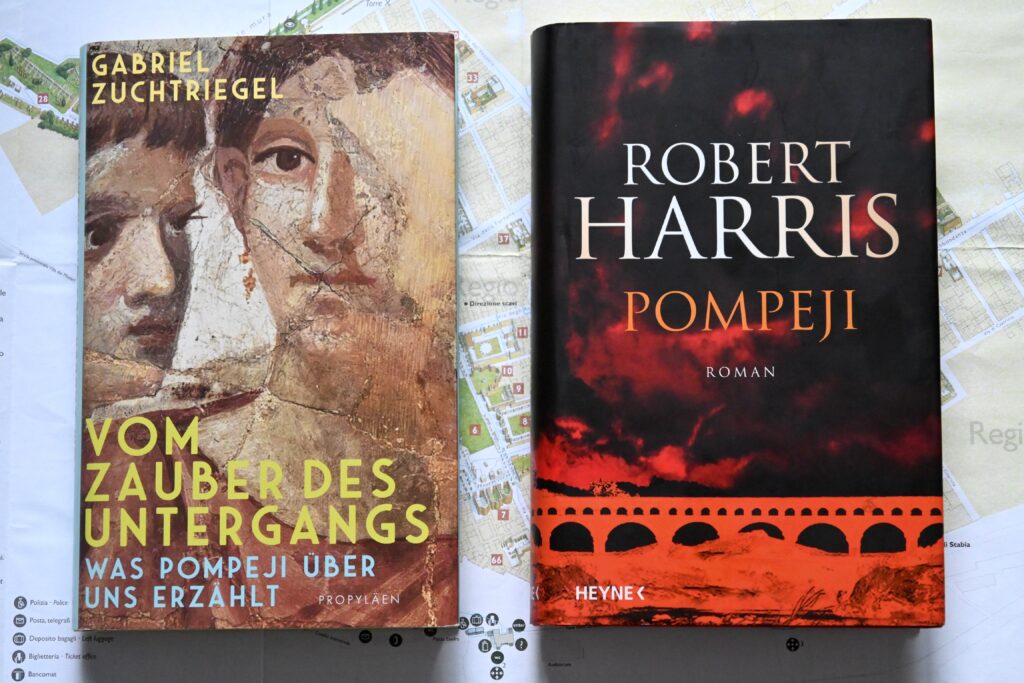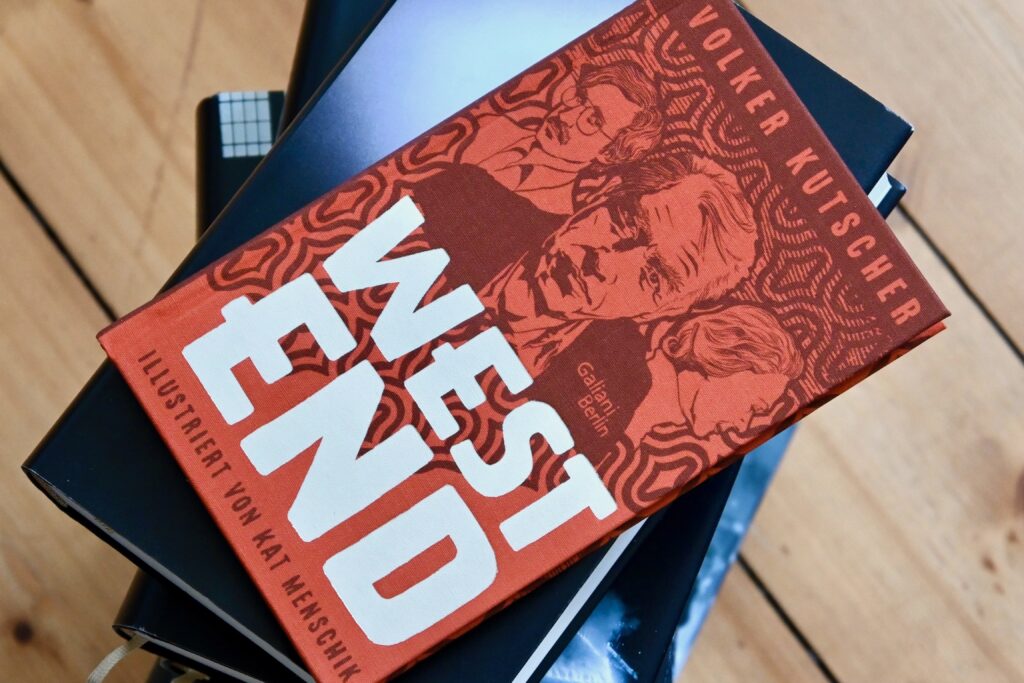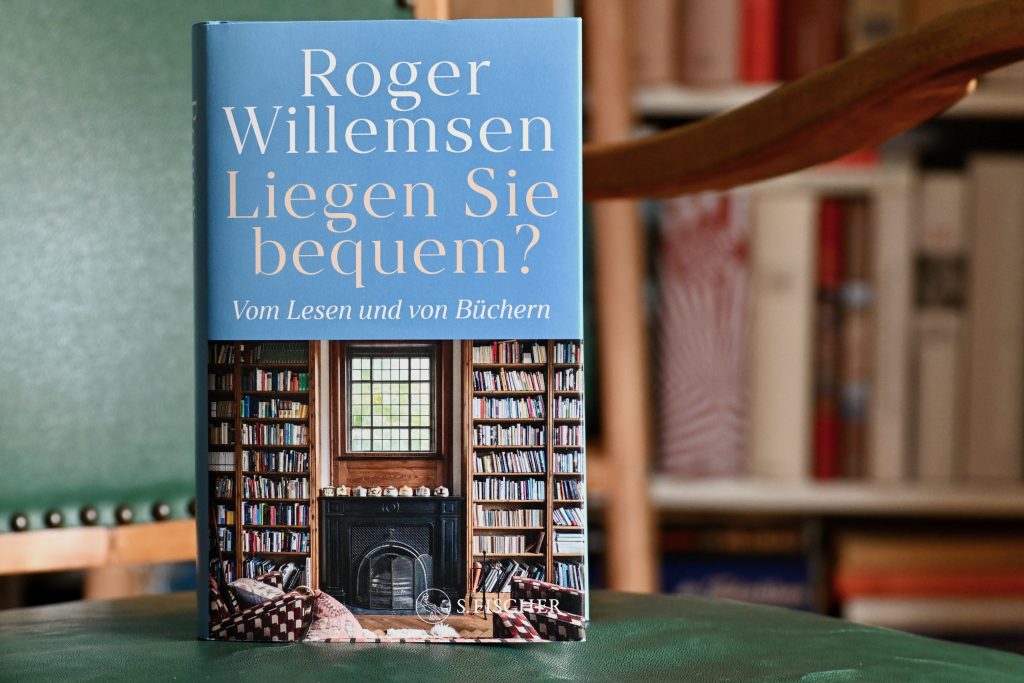1.461 Tage. Seit tausendvierhunderteinundsechzig Tagen überzieht das russische Terrorregime die Ukraine mit Krieg. Seit tausendvierhunderteinundsechzig Tagen werden ukrainische Städte, Dörfer, Landstriche verwüstet, sterben Menschen. Seit tausendvierhunderteinundsechzig Tagen leidet die ukrainische Bevölkerung unter Drohnen- und Raketenangriffen, unter zerstörter Infrastruktur, unter dem Horror des Angriffs eines größenwahnsinnigen Despoten. Seit vier Jahren tobt ein Krieg in Europa. Oder vielmehr: Seit vier Jahren führt Russland einen Krieg gegen Europa. Die Nachrichten darüber gehören inzwischen zum Alltag – so sehr, dass vielen von uns gar nicht mehr bewusst ist, was da eigentlich gerade geschieht, dort, weit im Osten unseres Kontinents. Der Roman »Die Nulllinie« von Szczepan Twardoch ändert das. Ändert das sehr drastisch – denn er schickt uns an jene Nulllinie, die nur ein anderes Wort ist für Front oder für Niemandsland.
Szczepan Twardoch, einer der wichtigsten polnischen Autoren unserer Zeit, nennt sein Buch im Untertitel »Roman aus dem Krieg«. Und das ist er. Denn Twardoch war vor Ort, brachte Hilfsgüter an die Front, war mit ukrainischen Soldaten unterwegs, schwebte in Lebensgefahr, sah all die Verwüstung mit eigenen Augen. Am Ende des Buches schreibt er: »›Die Nulllinie‹ ist ein Roman über den wirklichen Krieg, jedoch sind die darin beschriebenen Personen und Ereignisse fiktiv; sie müssen es sein, damit ich diesen Krieg so nah an der Wahrheit beschreiben kann, wie ich es vermag.«
Wir lernen Koń kennen, den 43jährigen Protagonisten des Romans, aber das ist nicht sein richtiger Name. Zusammen mit Ratte teilt er sich einen baufälligen Unterstand in einem zerschossenen Dorf, ein paar Ruinen weiter hausen Jagoda und Leopard. Die echten Namen kennt niemand, aber die sind auch nicht wichtig. Nichts ist mehr wichtig, außer das Überleben, zumindest noch für einen Tag. Die vier gehören zu einem ukrainischen Brückenkopf auf der falschen Seite des Flusses Dnipro. Sie spähen russische Bewegungen aus, wehren kleinere Angriffe ab, versuchen in Deckung zu bleiben. Denn dieser Krieg ist anders: auf der einen Seite vegetieren die Soldaten in Schlamm und Dreck vor sich hin, wie eh und je. Aber auf der anderen Seite sind Drohnen allgegenwärtig. Aufklärungsdrohnen, Drohnen mit Wärmebildsensoren, Kampfdrohnen mit Granaten, die aus der Luft töten und verstümmeln. Jede Bewegung kann die letzte sein. Beide Seiten haben diese Fluggeräte im Einsatz und bevor Koń hier im Dreck landete, gehörte er zu einer Drohneneinheit und war ziemlich gut darin, aus der Luft zu töten und zu verstümmeln.
Während ich das Buch gelesen habe, wurde mir ein Artikel in die Timeline auf Bluesky gespült: Bei einer NATO-Übung in Estland versuchten Einheiten von NATO-Soldaten aus zwölf Staaten zwei ukrainische Drohnenteams auszuschalten. Sie hatten keine Chance, an nur einem einzigen Übungstag setzten die Ukrainer die NATO-Bataillone schachmatt. Die Präsenz der Drohnen hat die Kriegsführung vollkommen verändert – und in Szczepan Twardochs Buch wird das mehr als deutlich. Denn sie sind überall. Immer, Tag und Nacht.
Die Handlung des Romans wirkt wie ein Kammerspiel des Grauens, ist eine Momentaufnahme aus dem Krieg. In mehreren Rückblicken erfahren wir viel über die Herkunft von Koń. Ein Pole mit ukrainischen Wurzeln, in Breslau aufgewachsen, Studium in Warschau, Althistoriker, akademische Laufbahn, Vater eines Sohnes – mit einem dunklen Schatten, der über seinem Leben liegt. Die Ukraine war ein fremdes Land für ihn, doch als sie von Russland überfallen wird und der Krieg ausbricht, gehört er zu denen, die Hilfsgüter von Polen aus in das bedrängte Nachbarland liefern. Immer wieder, unermüdlich. Bis ihm irgendwann klar wurde, dass er sich schon längst selbst verloren hat, dass es keinen Anker mehr gibt in seinem Leben. Dann meldet er sich freiwillig für die Armee. Und zieht in den Krieg.
»Dein Leben war einfach eine Handvoll Asche, die man mit leichter Hand in den Wind streut, wenn jemand darum bittet.«
Die Ähnlichkeit mit Robert Jordan aus Hemingways »Wem die Stunde schlägt« ist nicht zu übersehen, der Autor spielt damit, als an einer Stelle sich Jagoda mit Koń genau darüber unterhält: »Was dieser Jordan machte, das hatte Sinn. Dafür lohnte es sich zu sterben. Aber hier verrecken, Scheiße? Für nichts? Aus Dummheit?« Ein Gespräch im Schlamm.
Zahlreiche weitere Rückblenden zeigen andere Lebensläufe, zeigen Menschen, die ihren Halt verloren haben, die zynisch geworden sind, abgestumpft, die funktionieren, schießen, töten und getötet werden. Berichten über eine Armee, die permanent improvisiert, deren Drohnen oder Starlink-Empfänger durch Crowdfunding finanziert oder gleich selbst von den Soldaten gekauft werden. Schildern, wie gesellschaftliche Unterschiede unwichtig werden, wenn man Tag für Tag irgendwie überstehen muss. Beschreiben Menschen, die schon gestorben sind, auch wenn sie den Krieg überleben sollten – und niemand von ihnen rechnet damit. Die Welt, aus der sie kommen, sie »ist so weit entfernt, als hätte sie nie existiert.« Wir lesen über die Unzuverlässigkeit vieler Mitglieder der Internationalen Brigade, über Kolumbianer, die auf ukrainischer Seite kämpfen – manche von ihren Kartellbossen in den Krieg geschickt, um Kampferfahrung zu sammeln. Wir erfahren von den Gräueltaten der russischen Soldateska, von Exekutionen, von Vergewaltigungen und Folter. Und mit jedem Detail, mit jeder Seite verdichtet sich die Komplexität einer aus den Fugen geratenen Welt. Einer Welt in unserer Nachbarschaft, die von hier aus mit dem Zug oder Auto zu erreichen wäre. Sie ist nicht weit entfernt.
Zu Beginn des Buches muss man sich erst etwas gewöhnen an die Derbheit des Umgangstons, gespickt mit Kraftausdrücken, Abkürzungen und soldatischem Slang für Kriegsgerät. Es wird nichts erklärt, als Leser ist man hineingeworfen in eine fremde Umgebung. Ein »Zweihunderter« ist ein Gefallener, ein »Dreihunderter« ein Verwundeter, ein »Pokemon« ein Maschinengewehr. Gleichzeitig bricht in den Gedanken Końs immer wieder das Wissen eines Altphilologen durch, vermischen sich Erinnerungsfetzen an die Kriege zwischen Sparta und Athen, an die griechische Mythologie mit dem Dreck, dem Schlamm und der tödlichen Bedrohung durch die Drohnen – während immer wieder Zeitgeschichtliches tief in die Zeilen der Handlung eingeflochten ist. Dazu kommen Situationen, in denen die Soldaten Snickers essen, Kaffee aus Plastikbechern trinken, mit Hilfe von Google Meet und Starlink den Feed des Drohnenflugs an das Hauptquartier weiterleiten – es ist ein Einblick in einen Krieg zwischen Hightech und wackligen Provisorien.
In einem sehr lesenswerten Interview antwortete Szczepan Twardoch auf die Frage, was sein Antrieb sei, in diesem Krieg präsent zu sein, Hilfe zu liefern, die Soldaten vor Ort zu unterstützen:
»Weil es von meinem Wohnort Pirogovice in Oberschlesien anderthalb Tage mit dem Auto zu den Schützengräben im Donbass sind. Nur anderthalb Tage. Dieser Krieg ist so nah an meinem Zuhause. Er ist so nah an der Grenze meines Landes. Er betrifft mich so sehr, dass ich ihn nicht ignorieren konnte. Ich verspürte diesen Drang zu helfen, zumindest auf diese bescheidene Art und Weise, die mir möglich ist, zum Beispiel durch Spendensammeln, den Kauf von Ausrüstung wie Autos, Drohnen, Zielfernrohren für Gewehre und so weiter. Einfach um bei diesem großartigen und zugleich edlen Bemühen zu helfen, Menschen zu verteidigen, die so leben wollen, wie sie leben wollen, und nicht auf eine Art und Weise, die ihnen aufgezwungen werden soll.«
Entstanden ist daraus dieses Buch. Ein Buch, in dem es keine Hoffnung gibt auf ein Ende des Tötens. Ein Buch, in dem es keine Perspektiven gibt für die Menschen, die zwischen Dreck und Drohnen ihre Heimat verteidigen. Ein Buch, dass mit den Illusionen aufräumt, Verhandlungen mit einem verbrecherischen Aggressor seien möglich. Ein Buch also ohne Hoffnung, ohne Perspektiven und ohne Illusionen. Und genau deshalb ein Buch, das so viele Menschen lesen sollten wie möglich. Überall in Europa – denn dieser Krieg betrifft uns alle; der Gewaltherrscher im Kreml führt ihn im Schatten schon längst auch gegen uns. Und um ihn zu stoppen, benötigt die Ukraine alles an Unterstützung, was dafür nötig ist. So lange, wie es nötig ist.
Spenden für die Ukraine: StandForUkraine.com
Zum Weiterlesen:
Interview in der taz mit dem ukrainischen Schriftsteller Serhij Zhadan über die Veränderung der ukrainischen Gesellschaft durch Russlands Angriffskrieg.
Im Blog danares.mag gibt es die Beitragsreihe »Ukraine lesen« mit Besprechungen von Büchern ukrainischer Autorinnen und Autoren. Etwa des Romans »Ein Zuhause für Dom« von Victoria Amelina, die im Juni 2023 bei einem russischen Raketenangriff auf ein Restaurant getötet wurde.
Buchinformation
Szczepan Twardoch, Die Nulllinie
Aus dem Polnischen von Olaf Kühl
Rowohlt Berlin
ISBN 978-3-7371-0209-4
#SupportYourLocalBookstore