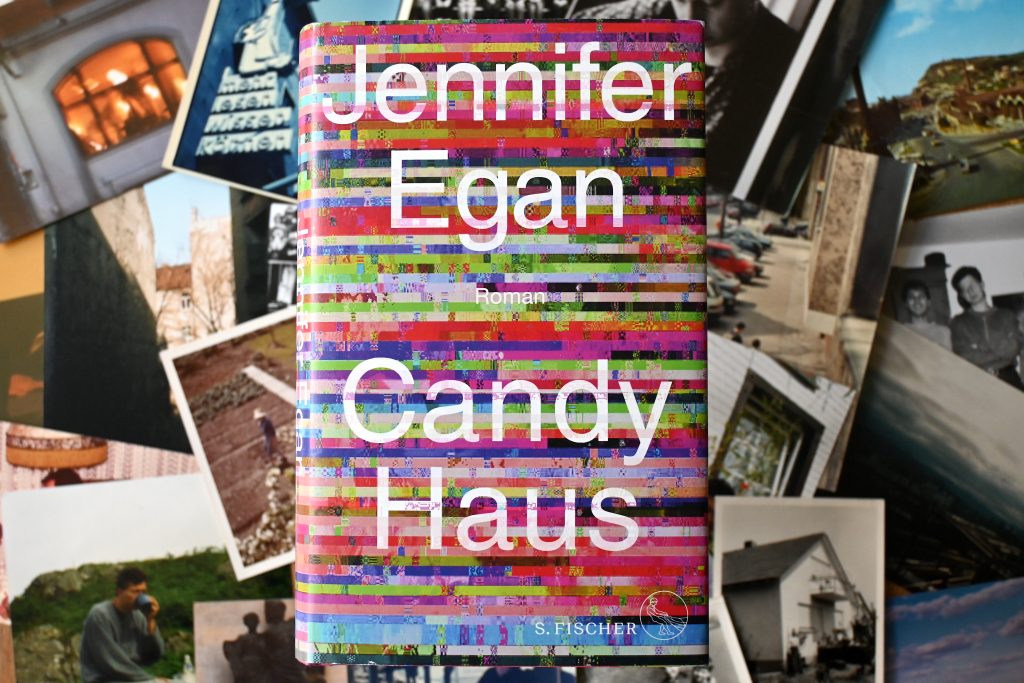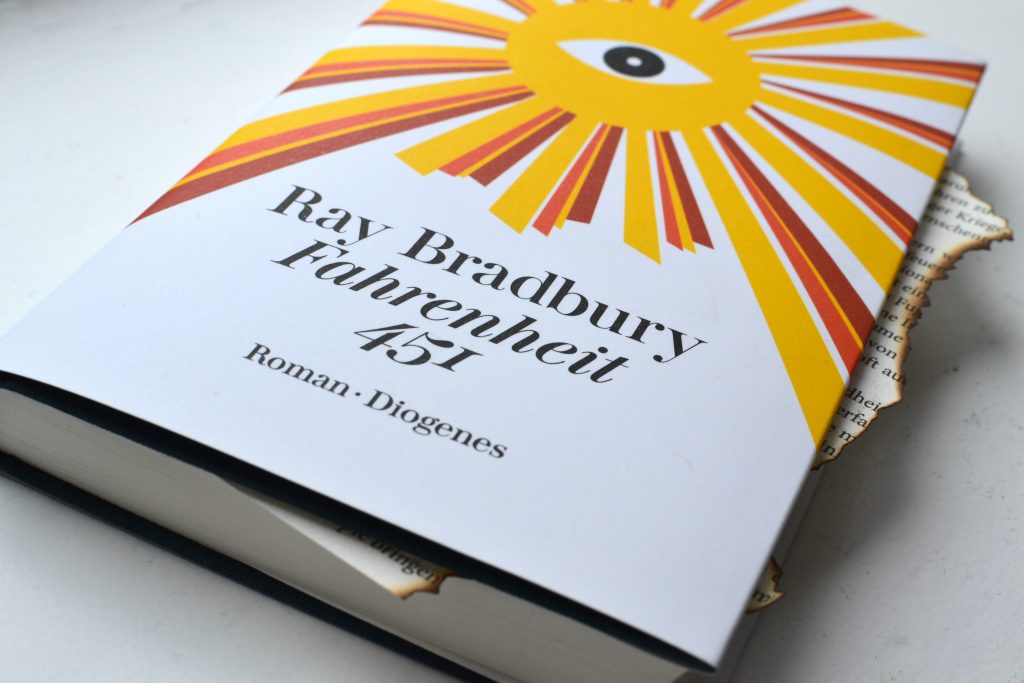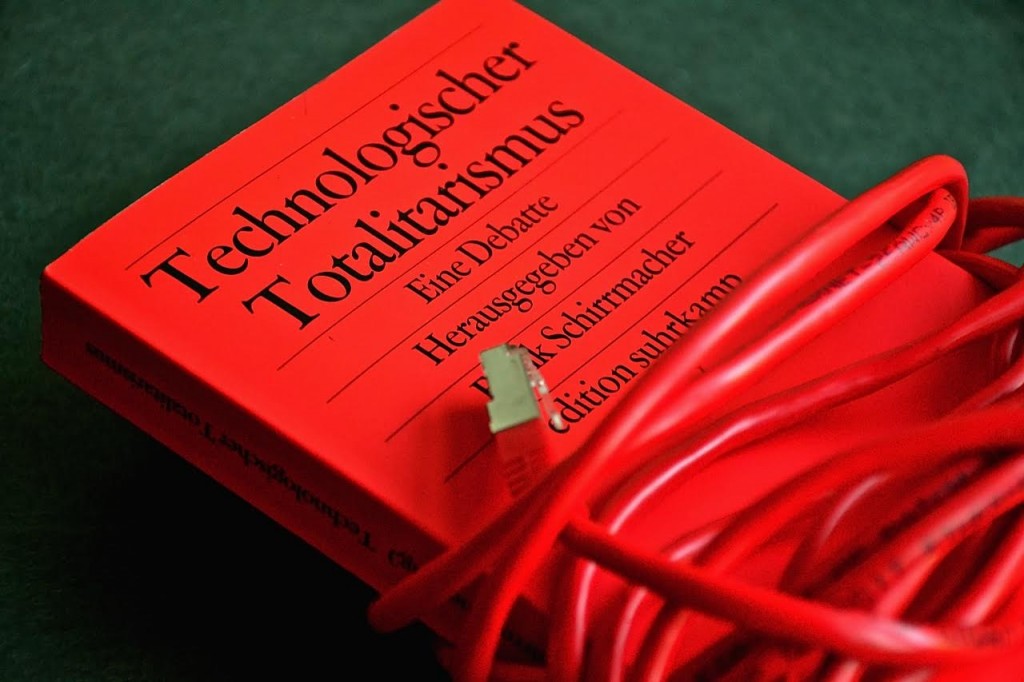Es war ein seltsamer Zufall: Beim Einkaufen dachte ich darüber nach, mit welchen Sätzen ich die Buchvorstellung des Romans »Going Zero« von Anthony McCarten beginnen könnte. Und während ich den Einkaufswagen durch die Gänge des Supermarkts schob, lief im Hintergrund der alte Police-Song »Every Breath You Take«. Ausgerechnet. »Every breath you take | And every move you make | Every bond you break | Every step you take | I’ll be watching you«: Auch wenn es darin eigentlich um das Psychogramm eines Stalkers geht, beschreiben diese fünf Songzeilen den perfekten Überwachungsstaat. Und genau davon erzählt »Going Zero«. Von der totalen Überwachung. Das ist natürlich kein neuer Romanstoff, da die Brisanz dieses Themas spätestens seit Edward Snowden allen Menschen klar sein dürfte. Doch Anthony McCarten wählt einen eher spielerischen Ansatz, um sich damit zu beschäftigen, zumindest zu Beginn der Handlung. Bevor einiges aus dem Ruder läuft. Na ja, eigentlich alles. „Every move you make“ weiterlesen
Seele zu verkaufen
»Wenn das Internet der Buchdruck wäre, würden wir gerade im Jahr 1460 leben.« Dieses Zitat habe ich schon einmal hier im Blog verwendet, ohne zu wissen, von wem es stammt. Aber es beschreibt, so finde ich, ziemlich gut die Dimension der technischen und gesellschaftlichen Umwälzungen, in denen wir uns befinden und die uns ein Leben lang begleiten werden. Ebenso wie die Leben der kommenden Generationen. Seit ich den Satz das erste Mal zitiert habe, sind inzwischen fast zehn Jahre vergangen; ich weiß immer noch nicht, woher ich ihn habe, aber wir wären nun im Jahr 1470 – und stehen gerade an der Schwelle zur nächsten Stufe der technischen Entwicklungen. Entwicklungen, die vermutlich drastische Auswirkungen auf unsere Zukunft und unser Verhalten haben werden. Der Roman »Candy Haus« von Jennifer Egan passt perfekt in unsere sich rasant verändernde Welt und ich habe ihn nicht nur mit großer Begeisterung, sondern auch mit einem leichten Gruseln gelesen. Denn die nahe Zukunft, in der er zum großen Teil spielt, könnte bald auch unsere Gegenwart sein – so eng liegen beide zusammen. „Seele zu verkaufen“ weiterlesen
»Fahrenheit 451«: Ein Interview zur Neuübersetzung
Der Dystopie-Klassiker »Fahrenheit 451« von Ray Bradbury wurde von Peter Torberg neu übersetzt. Entstanden ist dabei ein mitreißend erzählter Roman mit einer bildgewaltigen Sprache – ganz im Sinne des Autors, der dieses Buch seinerzeit in nur neun Tagen niederschrieb; seine Aufgewühltheit beim Verfassen des Textes ist in der Neuübertragung deutlich spürbar. Überhaupt verdanke ich der Übersetzungsleistung Peter Torbergs etliche großartige Leseerlebnisse; als Beispiele seien »Winters Knochen« von Daniel Woodrell, »Bitter Wash Road« von Gary Disher oder »Einsame Tiere« von Bruce Holbert genannt. Vor einiger Zeit hatten wir uns auf der Frankfurter Buchmesse auf einen Kaffee getroffen und ein Interview verabredet. Nun bot die Neuübersetzung von »Fahrenheit 451« einen guten Anlass, ihm Fragen zu seiner Tätigkeit zu stellen. „»Fahrenheit 451«: Ein Interview zur Neuübersetzung“ weiterlesen
Dokument der Hilflosigkeit
Flüchtlingskrise, ein Europa, das auseinanderzubrechen droht, ein neuer Kalter Krieg am Horizont – die Nachrichtenlage ist zur Zeit so bedrückend wie schon lange nicht mehr. Dabei gerät ein Thema völlig aus dem Fokus; ein Thema, das aber eine ebenso gewaltige Sprengkraft entfalten wird wie die genannten. Nur viel stiller und leiser. Denn wenn auch zur Zeit kaum darüber geredet oder berichtet wird, hat sich an der Brisanz der Datenüberwachung, des Datenmissbrauchs und der Datenspionage nichts geändert; sichere Regelungen sind weiter entfernt sind denn je. Es lohnt sich umso mehr ein Blick in das Buch »Technologischer Totalitarismus«, herausgegeben von Frank Schirrmacher. In dem 2014 gestarteten Leseprojekt Schöne neue, paranoide Welt hier auf Kaffeehaussitzer nimmt dieser Sammelband eine Schlüsselrolle ein, denn er vermittelt einen guten Eindruck über die Ratlosigkeit, mit der wir dem digitalen Umbau unserer Welt oftmals gegenüberstehen. „Dokument der Hilflosigkeit“ weiterlesen
Angststaat, aus Asche geboren
Diesmal war es verdammt knapp. Tel Aviv ist schwer zerstört, Tausende Menschen sind im Krieg gestorben und nur im letzten Moment konnte die israelische Armee die völlige Katastrophe verhindern. Danach hat sie umgehend die Macht übernommen, um das Land wieder zu stabilisieren, eine zivile Regierung existiert nicht mehr, Generalmajor Meni Schamai herrscht mit seiner Militärjunta über das Land. Das ist die Ausgangslage des Romans »Die Hände des Pianisten« von Yali Sobol, dessen Handlung in einer nahen Zukunft angesiedelt ist, »nach dem letzten Krieg«, und das könnte jederzeit sein.
Ist das ein Roman über den Nahost-Konflikt? Eigentlich nicht. Israel ist lediglich eine Metapher, es geht vor allem darum zu erzählen, wie schnell sich in einem Land im Ausnahmezustand totalitäre Strukturen verfestigen können und was dies mit den Bewohnern, den Menschen macht. „Angststaat, aus Asche geboren“ weiterlesen
Wollt ihr die totale Transparenz?
Vor ein paar Jahren behauptete eine Kollegin voller Überzeugung, dass man über sie nichts im Internet finden würde. Nach einer fünfminütigen, unangestrengten Google-Recherche wusste ich ihren zweiten Vornamen und ihre Mobiltelefonnummer. Aber das ist vollkommen harmlos, jedenfalls im Vergleich zu der völligen Transparenz, die zu erreichen sich die Firma Circle auf die Fahnen geschrieben hat. Circle ist so eine Art Über-Google, ein fiktives Unternehmen in einer nahen, sehr nahen Zukunft und der Namensgeber von Dave Eggers Roman: »Der Circle«. „Wollt ihr die totale Transparenz?“ weiterlesen