Ich liebe Venedig. Ich liebe alles an diesem Ort: das Prächtige, das Marode, das Vergängliche, das Neblige, das Grandiose, das Melancholische, das Labyrinthische, das Mystische, das Geschichtsträchtige, das Trotzige, das Zeitlose – eine ganz und gar unwahrscheinliche Stadt, schwebend zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart, einer ungewissen Zukunft entgegengehend. Und da ich dieses Venedig so sehr mag, war ich das letzte Mal vor über zwanzig Jahren dort und habe nicht vor, noch einmal dorthin zu fahren. Zumindest kann ich es mir momentan nicht vorstellen, denn ich möchte kein Teil des vollkommen außer Kontrolle geratenen Massentourismus sein, der alles an der Stadt zerstört, was sie ausmacht. Bei diesem letzten Aufenthalt vor mehr als zwei Jahrzehnten habe ich eine Woche lang die unvergleichliche Stimmung mit allen Sinnen genossen, war tage- und nächtelang in kleinen Gassen und an unzähligen Kanälen entlang unterwegs, konnte mich nicht sattsehen an den zahllosen Details dieser Stadt; die Bilder in diesem Blogbeitrag stammen von dieser Reise. Und natürlich ist es mir davor schon kaum möglich gewesen, an Büchern, deren Handlung in Venedig angesiedelt ist, vorbeizugehen. Daher war ich hocherfreut, den Roman »Garten der Engel« von David Hewson in die Hände zu bekommen. Und ich wurde nicht enttäuscht: das Buch führt uns auf zwei Zeitebenen durch die Geschichte der Lagunenstadt im 20. Jahrhundert. Eine wunderbar komponierte Handlung, voll finsterer Abgründe, verzweifelter Taten und überraschenden Wendungen. Und mit Venedig-Atmosphäre vom Allerfeinsten.
Zwei Zeitebenen also. Und drei Generationen. Die Rahmenhandlung ist im Jahr 1999 angesiedelt, der fünfzehnjährige Nico Uccello lebt mit seinem Vater und seinem Großvater, nonno Paolo, im Palazzo Colombina, einem viel zu großen Ort für die drei Menschen. Der Palazzo hat schon bessere Tage gesehen, die Backsteine bröckeln, der private Anlegesteg ist morsch. Die drei sind die letzten eines uralten Familienunternehmens – seit ewigen Zeiten betreibt die Familie Uccello eine Seidenweberei in Venedig. Jetzt, gegen Ende des 20. Jahrhunderts, scheinen ausländische Investoren die letzte Rettung zu sein, auch wenn sie letztendlich nur den traditionsreichen Namen übernehmen möchten. Nico interessiert das alles nicht, er möchte sich am liebsten mit Photographie beschäftigen und mit seinen Freunden abhängen. Während sein Vater auf permanenter Geschäftsreise zu sein scheint, kümmert sich sein Großvater um ihn – und Nico liebt und verehrt den alten Mann sehr. Doch die Geschichte beginnt in einem Krankenhaus: nonno Paolo ist todkrank, niemand weiß, wie lange er noch zu leben hat. Nico besucht seinen Großvater und wir sind mit dabei, wie er von ihm einen dicken, braunen Umschlag erhält. Den ersten von fünf. Sie alle enthalten Paolos Erinnerungen, die er für seinen Enkel aufgeschrieben hat. Und als Nico in den leeren Palazzo zurückkehrt, beginnt er zu lesen – erst aus Pflichtgefühl gegenüber nonno Paolo, dann mit zunehmender Faszination und mit wachsendem Entsetzen. Denn Paolos Aufzeichnungen beginnen im November 1943 und führen tief hinein in eine dunkle Zeit.
Es geht um die Menschen des Venedigs jener Jahre. Um »diejenigen, die siegten. Diejenigen, die verloren. Diejenigen, die dazwischen gefangen waren und nicht genau wussten, wohin sie gehörten. Und diejenigen, die nur abwarteten und zusahen, die glaubten, Dunkelheit, Schmerz und Verlust würden an ihnen vorübergehen, solange sie sich im Hintergrund hielten.«
Venedig im November 1943
Seit zwei Monaten hielt die deutsche Wehrmacht die Stadt besetzt. Die Jahre davor war Venedig einigermaßen unversehrt durch den Krieg gekommen, der weit weg zu sein schien. Doch als am 8. September 1943 der italienische König Viktor Emanuel das Bündnis mit Nazi-Deutschland aufkündigte und Mussolini stürzte, änderte sich alles. Die Wehrmacht wurde vom Verbündeten zum feindlichen Besatzer, Mussolini und ein paar Getreue agierten als faschistische Marionettenregierung von Hitlers Gnaden im Norden des Landes, während sich die Alliierten Kilometer um Kilometer durch Italien vorkämpften. Und nun ist auch Venedig zu einer von der Wehrmacht okkupierten Stadt geworden – mit dramatischen Folgen besonders für die jüdischen Einwohner. Sie waren zuvor schon von Mussolinis Faschisten drangsaliert und diskriminiert worden, doch die Deutschen kommen nun als Teil einer Vernichtungsmaschinerie. Aus ganz Europa werden jüdische Menschen in die Todeslager im Osten transportiert, auch in Venedig laufen die Vorbereitungen für die Deportation an. Gleichzeitig ist die allgemeine Versorgungslage prekär, es gibt zu wenig Nahrung, der kalte, nasse Winter steht vor der Türe, die Stadt ist voller Spitzel und Denunzianten und überall patrouillieren die Deutschen. Eine finstere Stimmung liegt über der Stadt in der Lagune.
Wir lernen Paolo Uccello als jungen Mann kennen. Er lebt alleine in einem abgelegenen Teil Venedigs, der kleinen Insel San Pietro di Castello, der äußerste östliche Bezirk, versteckt hinter dem alten Militärgebiet des Arsenale gelegen. Seine Eltern leben nicht mehr, er hält die alteingesessene, im Giardino degli Angeli gelegene Handweberei der Familie Uccello mit mageren Aufträgen gerade so über Wasser.
»Die Zeit vor dem Krieg war nur noch eine blasse Erinnerung, genau wie die Familie Uccello, als sie noch halbwegs wohlhabend war. … Rückblickend kam es Paolo vor, als wären sie andere Menschen gewesen, die in einer ganz anderen Welt gelebt hatten.«
Es ist ein besonderer Ort, diese kleine Insel am Rand der Stadt auf dem Wasser: Vergessen von allen, auch wenn sie nur eine Brücke weit vom Leben auf der Via Garibaldi entfernt liegt, einer der wenigen Straßen in Venedig, die durch einen zugeschütteten Kanal entstanden und die mit ihren Geschäften und einfachen Cafés das Zentrum dieses Arbeiterviertels ist. Paolo lebt als Außenseiter auf seiner Insel, alleine und zurückgezogen.
»Die meisten Venezianer schienen die Uccellos zu ignorieren. Früher wohlhabend, in ihren Augen zumindest, inzwischen verarmt und von niemanden mehr von Nutzen. Wenn er sich große Mühe gab, konnte er sich zurückgezogen hinter den Mauern des Giardino degli Angeli fast einreden, es gäbe keinen Krieg.«
Das Ghetto in Venedig
Die Insel San Pietro di Castello und die Via Garibaldi sind zwei der drei zentralen Orte der Romanhandlung. Der dritte liegt fast am anderen Ende von Venedig: das Ghetto Ebraico, das jüdische Ghetto. Es ist ein Ort mit langer Diskriminierungsgeschichte; zwischen 1516 und 1797 durfte der jüdische Teil der venezianischen Einwohnerschaft ausschließlich in einem bestimmten Teil der Stadt leben. Im Zentrum dieses Areals liegt eine kleine Insel inmitten der engen Bebauung, das Ghetto nuevo di Venezia. Und der Name »Ghetto« verbreitete sich von hier aus über die ganze Welt, bis heute.
Dieser Ort, diese kleine Insel macht etwas mit einem, er strahlt eine ganz eigene Stimmung aus. Hunderte von Jahren der Unterdrückung haben sich hier verewigt. Aber auch hunderte von Jahren des Weitermachens und des unerschütterlichen Vertrauens in eine Zukunft – allen Widrigkeiten und allen Gräueln der Geschichte zum Trotz. Bei meinem Venedig-Besuch saß ich dort eine ganze Weile auf einer Bank, mitten auf dem zentralen Platz, umgeben von alten, hohen Häusern. Eine Handvoll Bäume gibt es dort, die gerade dabei waren, ihre herbstlichen Blätter zu verlieren, während am Himmel dunkle Regenwolken aufzogen. Es war ein sehr besonderer Moment. An einem ganz besonderen Ort.
1943 lebten keine 300 Juden mehr in diesem Bezirk – der sich als Falle erweisen sollte. Kaum einer von ihnen überlebte die Shoah.
Schrecken und Schönheit
Tief hinein in diese Zeit des Grauens führt uns David Hewsons Roman, der bevölkert ist mit Personen, die sich gegen das Schicksal zu stemmen versuchen. Der junge Paolo Uccello wird aus seiner Abgeschiedenheit gerissen, als er – durch Vermittlung von Padre Filippo, einem Priester, der alles und jeden in dem Viertel kennt – einem Geschwisterpaar Unterschlupf gewährt. Micaela »Mika« und Giovanni, »Vanni« Artom sind Juden aus Turin, die zu einer Partisanengruppe gehören, deren letzte Aktion fehlgeschlagen ist. Die beiden sind erschöpft und verzweifelt und voller Wut und werden von den deutschen Besatzern gejagt. Sie zu verstecken ist eine Entscheidung, die vieles nach sich ziehen und die nicht nur Paolos Leben verändern wird – aber wie gravierend, kann er sich kaum vorstellen. Und wir Leser ebenfalls nicht.
Währenddessen bereiten die Mörder in Wehrmachts- und SS-Uniformen die Erfassung und Deportation der jüdischen Venezianer vor, unterstützt von Spitzeln, italienischen Faschisten und Kollaborateuren. Verzweifelt versuchen einige Wenige so viele Menschen zu retten wie möglich, irgendwie. Gleichzeitig kursieren Gerüchte über Anschlagspläne der Partisanen, die beiden Untergetauchten in Paolo Uccellos abgelegener Wohnung möchten ebenfalls nicht untätig warten. Nach und nach bringt der Autor seine Romanfiguren in ihre Positionen und in der Stadt auf dem Wasser mit ihrem unübersichtlichen Kanalnetz, den vielen kleinen Brücken, schmalen Durchgängen und ihren zahllosen Gassen nimmt ein Drama seinen Lauf. Ein Drama, das inmitten des winterlichen Venedigs, in Nebel, Kälte und Dunkelheit Auswirkungen haben wird bis in die Gegenwart. Bis zu dem Moment, als Nico Ucello die Aufzeichnungen seines Großvaters liest. Und der danach seine Stadt mit anderen Augen zu sehen beginnt: »Mehr und mehr hatte ich das Gefühl, durch zwei verschiedene Städte zu gehen. Das Venedig, in dem ich aufgewachsen war, und diese andere, dunklere, von Gewalt geprägte Stadt, die nonno Paolo gekannt hatte, als er kaum älter war als ich.«
Mit »Garten der Engel« hat David Hewson einen besonderen Venedig-Roman geschaffen. Auf der einen Seite erinnert er an die Zeit der Finsternis in Europa, während gleichzeitig die Liebe zu der unvergleichlichen Atmosphäre der Stadt auf dem Wasser überall zwischen den Zeilen hervorscheint. Schrecken und Schönheit. Filigrane, vergängliche, marode Schönheit.
Und ganz nebenbei hat das Buch eine Wissenslücke geschlossen. Denn damals sind mir die seltsam wuchtigen Schornsteine auf den Häusern der Lagunenstadt aufgefallen. Nun, 23 Jahre später habe ich mehr darüber erfahren: »Die Aussicht auf Feuer zwischen den dicht zusammengedrängten Häusern, von denen viele zur Hälfte aus Holz bestanden, machte den Venezianern schon seit Jahrhunderten Angst. Das war einer der Gründe, weshalb der Stadtrat beschlossen hatte, dass auf allen Dächern der Stadt konische Schornsteinköpfe verwendet werden mussten, in der Hoffnung, dass sie eventuell aufsteigende Funken besster zerstreuen würden.«
Wie gesagt, für mich ein ganz besonderer Venedig-Roman. Und ein paar Bilder gibt es auch noch.
Buchinformation
David Hewson, Garten der Engel
Aus dem Englischen von Birgit Salzmann
Folio Verlag
ISBN 978-3-85256-876-8
#SupportYourLocalBookstore

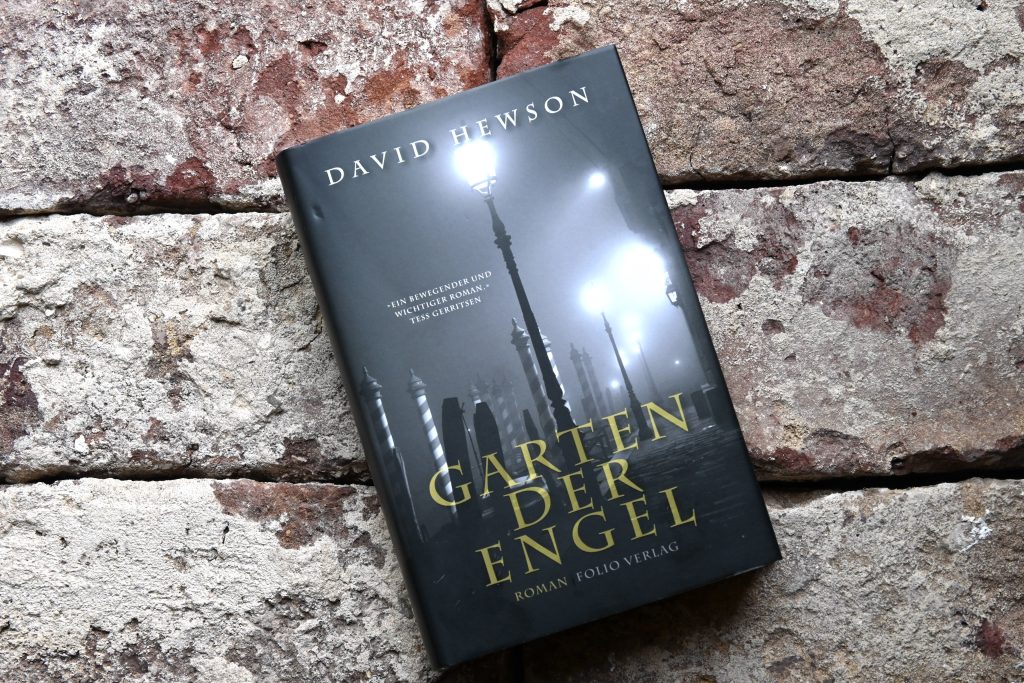










































Was für eine Vorstellung von Venedig! Die Stadt ist eben nicht nur eine Hochzeits-Idylle für Oligarchen, ein Point of Interest für Kreuzfahrt-Passagiere, Kriminalgeschichten in Buch, Film und Fernsehen oder Karnevals-Masken. Der engagiert vorgestellte Roman demaskiert und schildert ein dunkles Kapitel der faschistischen und nationalsozialistischen Geschichte.
Für die Besprechung und Bebilderung mit einem 36er Schwarz-Weiß-Film-Fotostreifen dankt Bernd